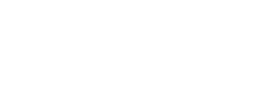Wer oder was sind die Eisheiligen?
Jedes Jahr im Mai blicken Gärtner, Landwirte und Wetterinteressierte gespannt auf die sogenannten „Eisheiligen“. Doch wer sind diese mysteriösen Wetterboten, wann treten sie auf und was bedeutet ihr Erscheinen für den Sommer?
Die Eisheiligen sind eine Wetterperiode, die traditionell zwischen dem 11. und 15. Mai liegt. Sie sind nach katholischen Heiligen benannt, die an diesen Tagen gefeiert.
Wann sind die Eisheiligen?
- 11. Mai – Mamertus
- 12. Mai – Pankratius
- 13. Mai – Servatius
- 14. Mai – Bonifatius
- 15. Mai – Sophia (auch „Kalte Sophie“ genannt)
Besonders die „Kalte Sophie“ am 15. Mai gilt als letzte kritische Marke für Spätfröste. Die Heilige Sophia erlitt den Martertod wahrscheinlich in der Verfolgung Diokletians um 304 und wird dargestellt als jugendliche Märtyrerin mit Palme/Lilie, Buch und Schwert. In manchen Regionen Deutschlands, vor allem im Süden, rechnet man die Eisheiligen nach dem gregorianischen Kalender sogar erst vom 19. bis 23. Mai.
Warum gibt es die Eisheiligen?
Meteorologisch gesehen handelt es sich bei den Eisheiligen um eine Wetterlage, die durch kalte Nord- und Ostwinde gekennzeichnet ist. Während der Frühling bereits warme Tage gebracht hat, können in dieser Phase polare Kaltluftströme Mitteleuropa erreichen und noch einmal für frostige Nächte sorgen. Diese Kälterückfälle sind vor allem für Hobbygärtner problematisch, da empfindliche Pflanzen wie Tomaten, Gurken oder Geranien unter den niedrigen Temperaturen leiden können.
Was bedeuten die Eisheiligen für den Sommer?
In der Bauernregel-Tradition heißt es, dass ein kalter Mai oft einen warmen Sommer bringt:
„Pankraz, Servaz, Bonifaz, machen erst dem Sommer Platz.“
Das bedeutet, wenn die Eisheiligen kühl ausfallen, besteht die Chance auf einen stabilen, warmen Sommer. Bleibt die Kälteperiode jedoch aus, kann der Sommer wechselhaft und durchwachsen werden. Allerdings ist diese Regel eher eine alte Wetterweisheit als eine wissenschaftlich fundierte Prognose.
Was sollten Gärtner beachten?
Die wichtigste Regel lautet: „Empfindliche Pflanzen erst nach den Eisheiligen ins Freie setzen!“ Wer sicher gehen will, sollte junge Setzlinge von Tomaten, Paprika oder Zucchini erst ab Mitte Mai oder Ende Mai ins Beet pflanzen. Falls es doch noch kalt wird, helfen Vlies, Folientunnel oder Gartenvlies, um die Pflanzen zu schützen.
Sind die Eisheiligen noch aktuell?
Durch den Klimawandel sind die klassischen Wetterphänomene der Eisheiligen nicht mehr so zuverlässig wie früher. Dennoch sind sie ein gutes Beispiel dafür, wie sich über Jahrhunderte Wettererfahrungen in Bauernregeln niedergeschlagen haben. Gärtner tun also gut daran, alte Weisheiten mit aktuellen Wetterprognosen zu kombinieren – und die Eisheiligen zumindest im Blick zu behalten.