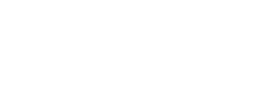Woher kommt die Tradition des Kranzwickelns im Sauerland?
Die Tradition des Kranzwickelns im Sauerland hat ihren Ursprung in alten, ländlich geprägten Bräuchen, die tief in der bäuerlichen und kirchlich-religiösen Kultur der Region verwurzelt sind. Es gibt verschiedene Varianten des Kranzwickelns, je nach Anlass – besonders bekannt sind Kränze für Fronleichnam, Erntedank, Hochzeiten oder Trauerfeiern. Auch im Rahmen von Schützenfesten ist das Kranzwickeln im Sauerland ein fester Bestandteil der Tradition.
Hier sind einige zentrale Hintergründe zur Herkunft:
Religiöse Wurzeln
In katholisch geprägten Regionen wie dem Sauerland wurden Kränze häufig zu Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt gebunden. Sie galten als Zeichen der Ehre, der Reinheit und als Opfergabe. Bei Prozessionen schmückte man mit Blumen und Kränzen Altäre oder Wege – eine symbolische Geste, um dem Göttlichen zu huldigen.
Bäuerliche Tradition und Jahreszeitenfeste
Kränze aus Getreide oder Blumen waren im bäuerlichen Leben Teil des Rhythmus von Aussaat und Ernte. Besonders zum Erntedankfest wurden Kränze als Symbol für Dankbarkeit gegenüber der Natur gebunden. Dabei verwendete man das, was auf den Feldern gewachsen war: Ähren, Kräuter, Blumen.
Sozialer Zusammenhalt und Vereinsleben
Im Sauerland, das stark von Dorf- und Vereinsstrukturen geprägt ist, hat sich das Kranzwickeln auch als geselliges Gemeinschaftsritual etabliert. Beim Schützenfest etwa wickeln Mitglieder der Dorfgemeinschaft Ehrenkränze für Majestäten oder Jubilare. Diese Rituale fördern den sozialen Zusammenhalt und sind Ausdruck regionaler Identität.
Symbolik des Kreises
Der Kranz – ein geschlossener Kreis – steht kulturübergreifend für Unendlichkeit, Gemeinschaft und Kontinuität. In der ländlichen Tradition des Sauerlands wurde diese Symbolik oft in das Dorfleben eingebettet. So wie das ganze Jahr im Rhythmus der Jahreszeiten durchlebt wird, schließt sie auch hier immer wieder ein weiterer Kreis.
Gelebte Tradition in Benolpe
Das Kranzwickeln im Sauerland ist also keine isolierte lokale Kuriosität, sondern Teil eines größeren kulturellen Musters, das religiöse, bäuerliche und gemeinschaftsstiftende Elemente miteinander verbindet. Es zeigt, wie stark Traditionen als Träger von Identität und Gemeinschaftssinn wirken – gerade in kulturell lebendigen Regionen wie dem Sauerland und lebenswerten Dörfern wie Benolpe.
Warum ist Tradition so wichtig?
Traditionen sind wichtig, weil sie mehr sind als bloße Wiederholungen alter Bräuche – sie stiften Identität, Orientierung und Gemeinschaft. In einer Welt, die sich ständig wandelt, geben sie Menschen Halt und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Traditionen machen sichtbar, wer wir sind und woher wir kommen – als Einzelne, als Familie, als Dorf, Region oder Nation. Sie schaffen Verbindung zu den Vorfahren, zur Heimat und zur eigenen Kultur.
Traditionen transportieren Werte, Normen und Weltbilder über Generationen hinweg. Dabei geht es oft um Respekt, Dankbarkeit, Maßhalten, Fürsorge oder auch Humor. Diese Werte werden nicht belehrend vermittelt, sondern erlebt – in Ritualen, Festen, Geschichten oder Symbolen.
In einer schnelllebigen und oft unübersichtlichen Welt geben Traditionen Struktur. Sie rhythmisieren das Jahr (z. B. mit Festen), das Leben (z. B. mit Ritualen wie Taufe, Hochzeit, Beerdigung) und manchmal sogar den Alltag. Sie helfen dabei, Krisen zu bewältigen, weil sie vertraut sind – gerade dann, wenn alles andere unsicher ist.


Maimbaumsetzen – woher kommt der Brauch?
Die Tradition des Maibaumaufstellens reicht bis ins Mittelalter zurück. Der Brauch des Maibaumsetzens ist eine alte Tradition, die in vielen europäischen Ländern, vor allem jedoch in Deutschland, Österreich und in Teilen Skandinaviens verbreitet ist. Er findet in der Regel am 1. Mai oder am Vorabend, dem 30. April, statt.
Der Maibaum ist ein langer, oft bunt geschmückter Pfahl oder Baumstamm, der als Symbol für den Frühling und die Fruchtbarkeit gilt. Besonders in Baden-Württemberg, Bayern und Österreich wird der Baumstamm feierlich auf dem Dorfplatz aufgerichtet. Der Baum wird am oberen Ende zumeist von einem Kranz und der grünen Baumspitze gekrönt. Die Herkunft des Maibaums und dessen Brauchtum sind umstritten.
Die Ursprünge des Maibaums reichen wahrscheinlich bis in die vorchristliche Zeit zurück, als Bäume eine zentrale Rolle in der religiösen Vorstellungswelt der germanischen und keltischen Völker spielten. Sie galten als heilig und waren oft Mittelpunkt von Ritualen, die den Wechsel der Jahreszeiten und die damit verbundenen landwirtschaftlichen Zyklen feierten. Im Laufe der Zeit verschmolzen diese heidnischen Bräuche mit christlichen Festen. (Wir kennen das ja schon von unserem Osterfeuer). In diesem Zusammenhang muss auch die von den Germanen verehrte Donareiche erwähnt werden, die dem Gott Donar bzw. Thor geweiht war und bei Geismar (Nordhessen) stand.

Denn nach einem überlieferten Bericht aus der Eifel gab es im 13. Jahrhundert in einigen Orten einen Pfingstbaum. Ebenfalls wird auch heute noch in Thüringen an etlichen Orten ein so genannter »Maien« zu Pfingsten gesetzt. Zudem wird der Maibaum in einigen Gegenden auch als »Marienbaum« bezeichnet. Die heutige Form des Maibaums, ein hoher Stamm mit belassener grüner Spitze und Kranz, ist seit dem 16. Jahrhundert überliefert. Ab dem 19. Jahrhundert kam er dann auch als Ortsmaibaum für die selbstständigen Gemeinden auf, auch als Zeichen ihres Selbstbewusstseins.
Der Maibaum wurde Teil der Feierlichkeiten zum 1. Mai, der in vielen Ländern als Tag der Arbeit bekannt ist, aber auch als ein Festtag zur Begrüßung des Frühlings verstanden wird. In vielen Gemeinden ist das Aufstellen des Maibaums ein großes Volksfest, bei dem oft auch Tänze, Spiele und Musik dargeboten werden.
Regional können die Bräuche stark variieren. In einigen Gegenden ist es üblich, dass die jungen Männer des Dorfes den Maibaum über Nacht bewachen, da es auch Brauch ist, dass rivalisierende Dörfer versuchen, den Maibaum zu stehlen. Der geschmückte Baum bleibt oft den ganzen Monat Mai über stehen und wird erst im Juni wieder abgebaut, wobei das Holz manchmal für Gemeinschaftsprojekte oder Feuer bei späteren Festlichkeiten verwendet wird.
Auch in Benolpe gibt es wieder den „Tanz in den Mai“! Wir freuen uns darauf, viele Freunde und Gäste am 30.04.2024 in der Schützenhalle begrüßen zu dürfen.
Quelle Fotos: unsplash.com

Benolper Schützenfestnachlese 2022
Die Benolper Schützen mussten lange warten, bis sie nach zwei ausgefallenen Schützenfesten endlich wieder so richtig feiern durften. Man war allseits gespannt, wie das erste Schützenfest in der Gemeinde bei den Besuchern ankam. Bereits um 15:30 Uhr trafen sich die Schützen in der Schützenhalle. In diesem Jahr sollte auch das ausgefallene Kaiserschießen aus dem Jahr 2020 nachgeholt werden. Daher wurde zunächst, begleitet von der Albaumer Musk, der amtierende Kaiser Dirk Japes abgeholt und anschließend der König Christian Löcker und der Jungschützenkönig Christian Picker.


(Alle Bilder vom Schützenfest unter www.mueller-benolpe.de)
Auf der Hardt entwickelte sich beim Kaiserschießen schnell ein spannender Dreikampf, den der 62jährige Schützenhauptmann Peter Hatzfeld mit dem 75 Schuss für sich gewinnen konnte. Das Nachsehen hatten seine Mitbewerber Martin Müller und Michael Lichtenthäler. Mit seiner Frau Antje Droste-Hatzfeld wird der neue Kaiser nun bis 2025 regieren. Die Jungschützen brauchten glatte 100 Schuss um dem neuen Jungschützenkönig Kevin Friedhoff nach gut einer Stunde zu gratulieren. Damit setzte sich der neue Regent gegen seine Mitbewerber Tom Löcker und Jonas Rinscheid durch. Der 21 Jahre alte Verwaltungsfachangestellte wählte sich die 17jährige Merve Japes zu seiner Jungschützenkönigin. Auch im dritten Wettbewerb ging es spannend zu. Zunächst schoss Dietmar Bertram die Krone, das Zepter ging an Walter Streletz und Niklas Rinscheid traf den Apfel. Dann war es der 50jährige Jens Eberts, der die letzten Reste des hölzernen Aars von der Stange holte. Der selbständigen Versicherungsvertreter setzte sich nach 75 Minuten mit dem 115 Schuss gegen seine Mitstreiter Mike Baumann, Niklas Rinscheid und Florian Braun durch. Zu seiner Königin wählte er sich seine Frau Ulli Eberts. Mit ihnen freuen sich die Kinder Antonia und Johanna. Nachdem die neuen Regenten auf der Vogelstange proklamiert wurden, ging es zurück zur Halle um bis spät in der Nacht das Tanzbein zu schwingen.
Der Samstag startete um 15:30 Uhr mit dem großen Festzug. Von der Schützenhalle marschierten die Mitglieder des Vereins los um die neuen Majestäten abzuholen. Musikalische Unterstützung bekamen die Albaumer Musiker mit ihren Dirigenten Wolfgang Schulte und Andreas Beckmann im Festzug durch den Musikverein aus Rahrbach, bei dem erstmals Sarah Otterbach den Taktstock schwang. Ebenfalls im Festzug mit dabei war der Tambourkorps Altenhundem unter der Leitung von Thomas Voss. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal ging es dann wieder zurück in die Schützenhalle. Da in diesem Jahr auch die Ehrungen der vergangenen Jahre nachgeholt wurden, fand anschießend die Ehrung der Schützen mit 25jähriger Mitgliedschaft statt. Nach der Königspolonaise wurde anschließend wieder tüchtig gefeiert. Die Tanzmusiker waren auch am 2ten Tag bestens aufgelegt und heizten die Stimmung tüchtig an. Ein spontanes weiteres Ständchen bekam der neue Kaiser von dem Tamborcorps Hofolpe, wo er selbst als Flötist mitwirkt.

Trotz kurzer Nachtruhe trafen sich am Sonntagmorgen zahlreiche Schützen vor der Halle ein, um gemeinsam zur Kirche zu marschieren. Die Messfeier hielt Pastor Lenz und die Orgel spielte Thomas Weidebach. Zurück zur Schützenhalle wurde den Besuchern zunächst ein kräftiges Frühstück angeboten. Doch bald fing der traditionelle Frühschoppen an. In dessen Verlauf wurden die zahlreichen weiteren Jubilare geehrt. Mit dem Orden für Verdienste um das Schützenwesen wurden zudem Florian Braun und Daniel Schmies ausgezeichnet. Den Orden für besondere Verdienste erhielt Philipp Streletz für seine langjährige Tätigkeit als Hallenwart. Nach der Verlosung kamen die Kinder bei dem Kindertanz auf ihre Kosten. Anschließend gaben die Albaumer Musiker noch einmal alles. Sie heizten den Schützen und Festbesuchern abermals tüchtig ein. Als die Musikinstrumente dann letztendlich doch eingepackt wurden, war es den meisten noch viel zu früh. Bis sich die Schützenhalle geleert hatte, dauerte es noch ziemlich lange. Fazit: Glück mit dem Wetter, tolle Stimmung, tolles Schützenfest – Dank an alle anwesenden Schützen und zahlreichen Besuchern von nah und fern.

Endlich ist es wieder soweit, Schützenfest Benolpe